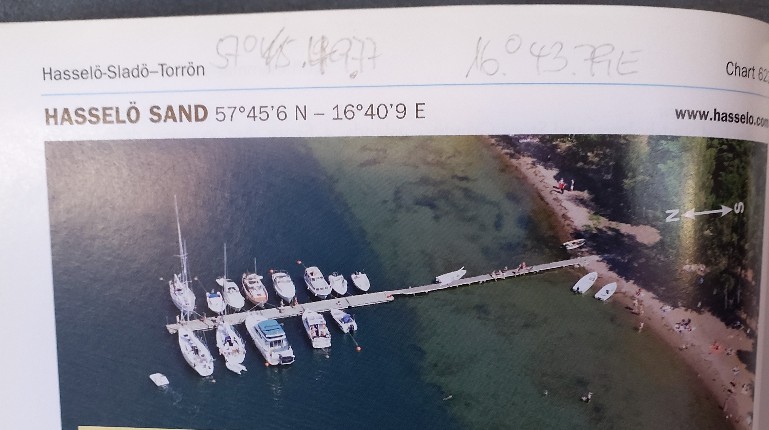Man hatte uns gewarnt: Harstena sei ein beliebtes Ausflugsziel und man müsse sich auf viel Trubel im Hafen und im Ort einstellen. Zumindest in der Saison.
Harstena ist die Hauptinsel einer Gruppe von Schären und Inseln. In Ost-West-Richtung dicht am äußeren Rand des Schärengürtels, in Nord-Süd-Richtung etwa da, wo es zum Göta-Kanal links ab geht.
Der Hafen ist Teil eines Sundes, der die Hauptinsel von ihrer unbewohnten Nachbarinsel trennt. Und der Trubel hält sich, zumindest zur Zeit noch, für mitteleuropäischen Geschmack, in überschaubaren Grenzen. Allerdings hat hier die Ferienzeit noch nicht angefangen, das geht erst übermorgen los.
Harstena hatte zu seiner “Blütezeit” etwa 70 Einwohner, die sich durch Robbenschlagen, Seevögel umbringen und Vogeleier einsammeln ernährten. Alles Dinge, die heute verboten sind und zudem auch nichts einbringen würden.
Heute liegt die Zahl ständiger Einwohner bei etwa 12. Allerdings gibt es etliche Sommerhäuser, die aber nur bei genauem Hinsehen als solche zu erkennen sind. Der Ort hat sein Aussehen seit dem vorvorigen Jahrhundert nicht wesentlich geändert. (Ich hörte hierzu “Wie Bullerbü”.) Und das ist wohl, neben der großartigen Landschaft, ein Grund für die vielen Touristen, die hierher kommen.

Touristen sind natürlich die anderen, nicht wir!
Man merkt aber schon, wenn die beiden Kreuzfahrtschiffe wieder abgelegt haben. Dann kehrt mehr Ruhe ein. Und das Inselmuseum schließt pünktlich zur Abfahrt. Was wir nicht wussten und somit die Trankocherei nicht besichtigen konnten. Die steht nämlich am äußersten Ende des Ortes, verständlicherweise. Stinkt aber nicht mehr, kein Mensch braucht heute noch Robbentran.